Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch

Martin Schlegel: Das Mandat der Nationalbank ist in Verfassung und Gesetz festgehalten: Die SNB verfolgt eine Geld- und Währungspolitik im Gesamtinteresse des Landes. Das heisst konkret, dass wir Preisstabilität gewährleisten, unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung. Preisstabilität heisst für uns, dass die Konsumentenpreise jährlich weniger als zwei Prozent steigen.
Die SNB überprüft ihre Geldpolitik quartalsweise in sogenannten Lagebeurteilungen. Der Prozess der Lagebeurteilung dauert mehrere Wochen und beginnt mit einer breiten Auslegeordnung – nationale und internationale Konjunkturlage, Wachstumsprognosen, Lage an den Finanzmärkten, Inflation etc. Dann findet eine intensive Diskussion statt, in der das Direktorium, die stellvertretenden Direktoriumsmitglieder und mehrere Dutzend Fachexperten involviert sind. Anschliessend zieht sich ein kleinerer Kreis zurück und das Direktorium fällt den Entscheid, der darauf an einer Medienkonferenz kommuniziert und erklärt wird.
Die Schweizer Wirtschaft ist sehr stark mit dem Ausland verflochten. Der Wechselkurs spielt eine wichtige Rolle für die Inflationsentwicklung und damit auch für unsere Geldpolitik. Auch wenn wir die Geldpolitik für die Schweiz machen, müssen wir natürlich die Konjunktur im Ausland und die Wechselkursbewegungen mitbeachten.
Der Schweizer Franken hat die Rolle einer Safe-Haven-Währung, was durchaus als Kompliment an die Schweiz bewertet werden kann, denn es spiegelt die Stabilität unseres Landes. Das heisst aber auch, dass in Krisensituationen, in denen die Wirtschaft bereits belastet ist, Aufwertungsdruck auf den Franken entstehen kann, was die Lage für die Unternehmen zusätzlich erschwert.
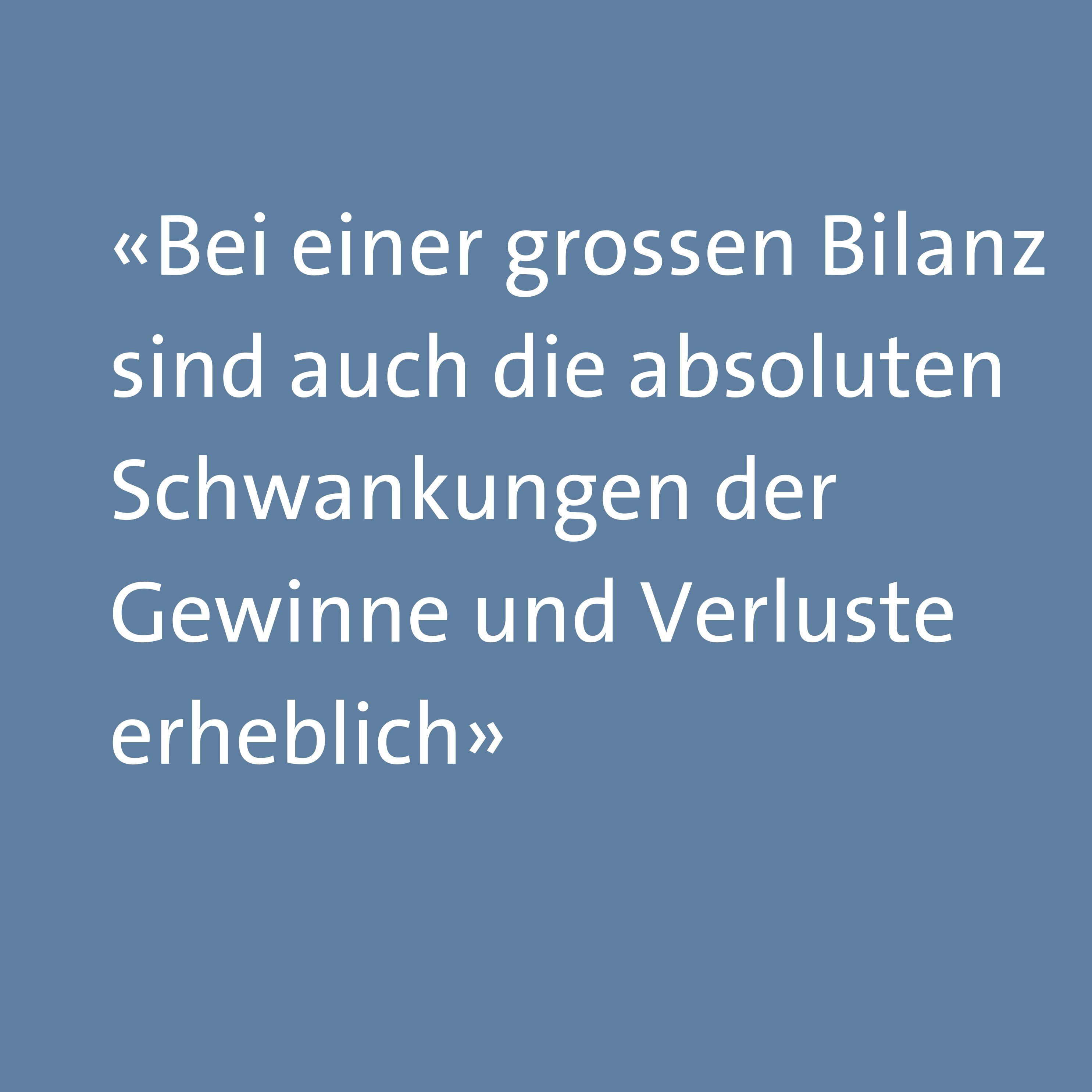
Die Bilanz ist als Folge der Devisenmarktinterventionen stark gewachsen. Um die Aufwertung des Frankens zu dämpfen, haben wir im Zeitraum zwischen der globalen Finanzkrise und der Pandemie grosse Mengen an Fremdwährungen gekauft. Das war ein geldpolitischer Entscheid, der sich in der Ausweitung der Bilanz niederschlug. Die Bilanzsumme der SNB betrug per Ende 2023 rund 800 Milliarden Franken. Der grösste Teil davon sind Devisenanlagen, deren Wert von der Entwicklung an den Finanzmärkten abhängt. Bei einer grossen Bilanz sind auch die absoluten Schwankungen der Gewinne und Verluste erheblich. Die Risiken versuchen wir zu reduzieren, indem wir unsere Anlagen breit diversifizieren.
Das grösste Risiko unserer Bilanz ist der Wechselkurs des Schweizer Frankens. Dieses Risiko können wir nicht absichern, weil dies eine Nachfrage nach Franken bedeuten würde und damit einen geldpolitischen Effekt hätte.
Entscheide der SNB haben eine grosse Tragweite. Dieser Verantwortung muss man sich als Mitglied des Direktoriums bewusst sein. Aber wir haben ein hervorragendes Team von Expertinnen und Experten bei der SNB, die unsere Entscheidungen umfassend vorbereiten, sodass wir im Direktorium fundiert und nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden können.
Ein aktuelles Beispiel wäre die Krise der Credit Suisse. Es gab Stimmen, die sagten, die SNB hätte von Anfang an kommunizieren sollen, dass sie die Credit Suisse unter allen Umständen retten würde. Dazu hat die Nationalbank aber kein Mandat. Einer Bank finanzielle Garantien zu leisten, ist ein Entscheid, der nur durch die Politik gefällt werden kann.
Die SNB kann jedoch in ihrer Rolle als «Kreditgeberin der letzten Instanz» unterstützen. Sie kann einer Bank, die sich am Markt nicht mehr finanzieren kann, Kredite gegen Sicherheiten gewähren, um kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Diese Finanzierung war im Fall der Credit Suisse ausschlaggebend für die Bewältigung der Krise.
Das grundlegende Problem der Credit Suisse, der Vertrauensverlust, konnte mit der Übernahme durch UBS gelöst werden. Die SNB hat die dafür nötige Liquidität bereitgestellt.
Wir pflegen einen sehr engen Austausch mit der Wissenschaft, auch personell. Wir arbeiten mit denselben Modellen und Methoden und integrieren die neusten Erkenntnisse der Wissenschaft in unsere Arbeit. Ein Unterschied ist jedoch, dass ökonomische Schocks bei uns natürlich nicht nur ein «ε» in einer Gleichung sind, sondern direkte Auswirkungen auf das Leben der Bevölkerung haben, und wir unter Zeitdruck und unvollständiger Information Entscheide treffen müssen.
Es ist Modellen eigen, dass sie vereinfachen und nur Teilaspekte der Realität abbilden können. Bei der Inflations- und Konjunkturprognose sind sie eine wichtige Grundlage. Allerdings müssen diese quantitativen Modelle mit qualitativen Informationen ergänzt werden. Eine Quelle dafür ist das Netz von Delegierten für regionale Wirtschaftskontakte der SNB. Wir führen pro Jahr ungefähr 900 Gespräche mit Unternehmen, um genau solche qualitativen Informationen einzuholen, die dann in unsere Entscheidungen ergänzend zu den Modellen einfliessen.
Dies ist eine gekürzte Version des im Magazin .inspired erschienen Interviews. Das ganze Interview kann im Magazin (PDF, 4 MB) nachgelesen werden.